Der ERP-Guru als Fachautor
Was Sie schon immer über die ERP-Welt wissen wollten …
ERP-Systeme sind wie Straßenverkehr. Wir können Parallelen zwischen ERP-Systemen, Entenhausen und dem Zweiten thermodynamischen Hauptsatz ziehen; man muss nicht Donaldist sein, um dies zu verstehen. Zum ersten Mal wird klar, wie sogar Goethes Osterspaziergang (Faust, Teil I) in Verbindung mit ERP-Systemen gebracht werden kann.
Daneben erscheint eine Aussage wie „Durchschnittspreis ist nicht gleich Durchschnittspreis“ trivial. Oder die Beantwortung der Frage „Wie finde ich Berater mit fehlendem Talent?“. Die Antwort: Im Handumdrehen. Wussten Sie, dass Modernität nichts mit Softwareergonomie zu tun hat? Kennen Sie einleuchtende Argumente, dass heutige Softwarestrukturen mit alten ehrwürdigen Traktoren vergleichbar sind? Eine Frage dagegen ist latent allzeit bekannt: Habe ich wirklich das richtige ERP-System? Die Unternehmen bewegen sich in einem Erlebnispark mit vielen unerwarteten Attraktionen. Und dann die Schlagzeile: ERP-Systeme übernehmen Vormundschaft.
Die ERP-Welt ist intellektuelle Krimiunterhaltung. Es handelt sich nicht um seichte Unterhaltung á la DSDS. Wir erleben tagtäglich Shows wie USUS „Unternehmen sucht Universalsystem“, USPS „Unternehmen sucht passendes System“, USSR „Unternehmen stürmt Software-Ruine“ oder USTB „Unternehmen sucht talentierten Berater“.
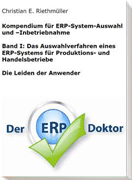 Der ERP-Doktor
Der ERP-Doktor
Kompendium für ERP-System-Auswahl und -Inbetriebnahme Band I
Mit dem Kompendium für ERP-System-Auswahl und –Inbetriebnahme erleben Sie über 800 Seiten geballtes ERP-Wissen – erlebte und gelebte ERP-Erlebniswelt! Keine Theorie, erlebte Praxis. Mit der Kernaussage: Die Anwendung gehört den Anwendern!
Kompendium für ERP-System-Auswahl und –Inbetriebnahme Band I:
Das Auswahlverfahren eines ERP-Systems für Produktions- und Handelsbetriebe.
Die Leiden der Anwender
Verlag ReDiRoma Remscheid 2008; ISBN 978-3-86870-008-4
http://www.rediroma-verlag.de/index.php?det=188
Auf Basis der ERP-System-Marktsituation in 2007 und Anfang 2008 werden die Hürden aufgezeigt, die ein Anwender bei einer Systemauswahl überwinden muss. Der Leser lernt viele (bekannte und unübliche) Elemente von Kategorisierungen der Systeme und Anbieter kennen, damit er in der Lage ist, von vornherein den richtigen Kreis der in die Auswahl einzubeziehenden Systeme festzulegen. In der Auswahlphase und insbesondere während der Systempräsentationen können viele Fehler begangen werden, die zu einer weniger guten Entscheidung führen, die bei einer richtigen und konsequenten Vorbereitung vermieden werden könnten. Dazu gehören die Projektvorbereitungsarbeiten, die Aufbereitung der eigenen Prozesse und Daten, die Projektplanung, die Festlegung der mit dem neuen System zu erreichenden Ziele, die Auseinandersetzung mit der eigenen Organisation.
Eine ERP-Systemauswahl ist eben nicht mit der Auswahl eines Schreib- oder Tabellenkalkulationsprogramms zu vergleichen. Der Anwender verheiratet sich auf Jahre mit dem neuen System und dem Systemanbieter.
Der Autor beschreibt einen Weg durch den ERP-Dschungel, der dem Anwender eine möglichst friktionsfreie Projektdurchführung und Entscheidungssituation ermöglicht. Dieses Werk ist praxisgetrieben.
Mittlerweile haben sich derart viele Änderungen auf dem Softwaremarkt ergeben, dass dieses Buch nur noch über einen gewissen „historischen“ Wert verfügt; hier ist eine Komplettüberarbeitung in Planung.
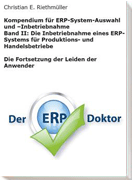 Der ERP-Doktor
Der ERP-Doktor
Kompendium für ERP-System-Auswahl und -Inbetriebnahme Band II
Mit dem Kompendium für ERP-System-Auswahl und –Inbetriebnahme erleben Sie über 800 Seiten geballtes ERP-Wissen – erlebte und gelebte ERP-Erlebniswelt! Keine Theorie, erlebte Praxis. Mit der Kernaussage: Die Anwendung gehört den Anwendern!
Kompendium für ERP-System-Auswahl und –Inbetriebnahme Band II:
Die Inbetriebnahme eines ERP-Systems für Produktions- und Handelsbetriebe.
Die Fortsetzung der Leiden der Anwender
Verlag ReDiRoma Remscheid 2011; ISBN 978-3-86870-184-5
http://www.rediroma-verlag.de/index.php?det=554
Ein Systemauswahlverfahren garantiert häufig keine erfolgreiche Inbetriebnahme des ausgewählten Systems: Die System-Oberfläche hat alles überstrahlt. Es fehlt an der notwendigen Flexibilität der freien Gestaltung, die Systemeigenschaften unterstützen nicht die Unternehmens-Kernkompetenz. Die Anwendung gehört nicht den Anwendern, Technologen bevormunden die Anwender durch ihre Mikrowelten. Objektrelationale Datenmodelle beinhalten keine Objektorientierung. Die Datenqualität in der Alt-Anwendung wird überschätzt, so dass Datenmigration und Datenstrukturaufbau von dem bisherigen Datenmüll im neuen System geprägt sind. Spät wird erkannt, dass sich ein Bewertungsbruch in der Bewertung des Umlaufvermögens vollzieht, die Kalkulation zu gravierend abweichenden Ergebnissen führt.
Das Unternehmen muss versuchen, mit höchstmöglicher Performance von Mitarbeitern und System zu starten und die ersten Wochen mit erwarteten, aber akzeptablen und reparablen Einbrüchen zu überstehen.
Die Durchführungsform der Inbetriebnahme entscheidet über Wohl und Wehe eines Unternehmens. Der Autor beschreibt Wege und Irrwege durch die vielfältigen Inbetriebnahmevarianten, wie ein Unternehmen in eine neue ERP-Anwendungswelt gelangt. Friktionsfreiheit ist fast nicht vorstellbar. Wie im Auswahlverfahren können in der Inbetriebnahme vielfältige Fehler begangen werden, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Dieses Werk ist praxisgetrieben.
 ERP-Projekte
ERP-Projekte
zwischen Risiko und Erfolg
Ein Leitfaden zu Systemauswahl und -Inbetriebnahme
Beuth-Verlag Berlin 2012; ISBN 978-3-410-21335-2, als E-Book ISBN 978-3-410-21336-9
Mein Leitsatz in der ERP-Systemwelt lautet „Die Anwendung gehört den Anwendern!“. Auch wenn viele diese Aussage belächeln mögen, trifft sie weitwrhin den Kern der Problematik heutiger ERP-Systeme: Technologen geben oft vor, was die Systeme leisten sollen, sie lassen sich dabei von der technologischen Komplexität treiben, ohne zu beachten, dass die Anwender Systeme benötigen, die sie beherrschen können. Die Systeme beherrschen verstärkt die Unternehmen. Bei den meisten ERP-Anwendungen kann man feststellen, dass sich die Anwender erzwungenermaßen mit dem System und damit mit einer weniger kernkompetent ausgelegten Funktionalität arrangieren, weil sie ihre Interessen und Anforderungen nicht durchsetzen können. Ein ERP-System muss Individualität unterstützen, und es muss für ein Unternehmen möglich sein, seinen eigenen Lösungsweg zu beschreiten und seine Kernkompetenzen abzubilden. Wenn ein System durch seine Komplexität und die nicht realisierte Kernkompetenz die Bedürfnisse der Anwender nicht abdeckt, werden Anwender versuchen, die Systeme auszuhebeln, indem sie am System vorbeiarbeiten.
Den Anwendern soll die Arbeit im System „Spaß“ bereiten, das fängt beim Verständnis über die Rahmenbedingungen der Funktionen an. Anwender sollen mitdenken, sie sollen bei der Weiterentwicklung der Organisation gehört werden und beteiligt sein. Fordern Anwender eine zweckmäßige Änderung im Ablauf, die mehr Sicherheit bringt oder Kosten einspart, soll der Systemverantwortliche in der Lage sein, diese Änderung am nächsten Tag, in jedem Fall aber kurzfristig zu präsentieren. Das System darf eine derartige Änderung nicht „übel“ nehmen, wenn die Lösung sich nicht bewährt, dann muss sie auch wieder ad hoc neu gestaltbar sein, sie wird gegen eine neue ausgetauscht. Dieses Vorgehen hat etwas mit dem Abschalten von Komplexität im System zu tun.
Daher stellt dieses Buch verstärkt die Komplexitätsabstellschalter heraus: In der Auswahl müssen die Komplexitätsschalter gefunden werden, die nur die On-Stellung kennen, um den Komplexitätsgrad eines Systems zu erkennen, während der Inbetriebnahmephase sind die Komplexitätsmauern einzureißen, um zu einer handhabbaren, die Erfordernisse erfüllenden Lösung zu gelangen.
Aber nicht nur die ERP-System-Hersteller müssen auf die Anforderungen der Anwender zugehen, die Berater müssen auch neue Wege zu einer Anwenderzentrierung beschreiten. Es dürfen nicht die untauglichen Abläufe der Systeme verteidigt und dann auch noch eingeführt werden, sondern die Berater müssen gemeinsam mit dem Unternehmen zu neuen Ufern, zu neuen Anwendungslösungen gelangen. Das Risiko allein liegt nicht nur in der richtigen Auswahl eines Systems, sondern auch in der professionellen ziel- und damit kompetenzorientierten Beratung.
In einem ERP-System sind viele Ergänzungen notwendig. Jede Ergänzung im relationalen Datenmodell führt zu vielen neuen Relationen. Relationale Modelle decken aber unsere Realität nicht hinreichend ab.. Jede weitere Relation erhöht im Datenmodell die Komplexität des ERP-Systems, ohne dass dadurch jedoch die Realität besser abgebildet wird. Relationale Datenbanken werden in Zukunft durch andere Datenbankarten ersetzt werden, der Zeitraum ist noch unbestimmt, und die Entwicklung wird vielleicht zu objektorientierten Datenbanken führen, andere plädieren zu spaltenorientierten In-Memory-Datenbanken.
Eine abschließende Frage soll als Denkanstoß noch formuliert werden: Haben wir eigentlich heute überhaupt den Zustand „ERP“ erreicht, wenn ERP als Steuerung des gesamten Betriebes interpretiert wird? Wozu werden dann CRM, SRM, Leitstand und all die anderen Teilsysteme benötigt? Sind diese nicht auch „ERP“? Wird hier eventuell eine Fiktion verfolgt, die es in Wirklichkeit nicht gibt? ERP scheint ein Fragment zu sein, so stellt es sich am Markt dar. Eine Steuerung ist zudem permanent zu justieren und anzupassen, was eben zu der Forderung führt, dass die Systeme in der Anwendung ständig an die in- und externen Änderungen angepasst werden können, zusammengefasst unter dem Stichwort Flexibilität, ohne dass jedes Mal Systeme nur durch Programmierung verändert werden können.
Das Buch richtet sich vor allem an Leser, die in einem Systemauswahl- oder –Inbetriebnahmeverfahren beteiligt sind, speziell an Projektleiter, IT-Leiter und Geschäftsführer.